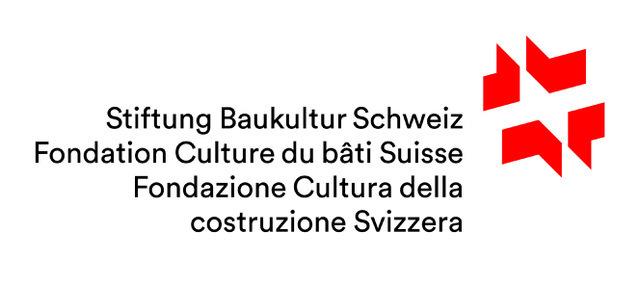Ariane Widmer referiert im historischen Gebäude über die Zukunft der Schweizer Stadt. © Caroline Tanner
28 février 2025
Stiftung Baukultur Schweiz | D'un point vue personnel
Die Zukunft der Schweizer Städte
Anlässlich der Gründung der Parlamentarischen Gruppe Städte hielt Stiftungsrätin Ariane Widmer im Herbst 2024 ein inspirierendes Referat zur Zukunft der Stadt. Unter dem Titel «Wohin geht die Schweizer Stadt?» teilte sie praxisnahe Einblicke aus ihrer langjährigen Erfahrung u.a. als Kantonsplanerin von Genf und skizzierte, wie die Herausforderungen der Stadtentwicklung gemeinsam bewältigt werden können.
Die Stadt als wertvolles Erbe
Ziel der neu gegründeten parlamentarischen Gruppe Städte ist es, den Austausch zwischen den Städten und der Bundespolitik zu fördern. Der Gründungsanlass fand im historischen Erlacherhof in Bern statt – eine passende Kulisse, um die Bedeutung der Baukultur hervorzuheben. Was die anwesenden Mitglieder der eidgenössischen Räte, die Stadtpräsident:innen, sowie die Vertreter:innen des Städte- und Gemeindeverbandes verbindet, ist ihr Engagement für Schweizer Städte. Doch wie lässt sich eine Vision für die Zukunft der Schweizer Städte beschreiben?

Der Veranstaltungsort Bern ist exemplarisch für eine im Mittelalter gegründete Stadt, deren Grenzen damals klarer erkennbar waren als heute. © ETH-Bibliothek Zürich/Bildarchiv
Ariane Widmer stellte in ihrem Referat klar: Eine Vision für die Zukunft der Schweizer Städte muss auf den Prinzipien von Nachhaltigkeit, Lebensqualität und Baukultur beruhen. Besonders das Modell der Nachverdichtung und die Stadt der kurzen Wege spielen dabei eine zentrale Rolle. Angesichts des demografischen Wachstums und der klimatischen Veränderungen müssen Städte umdenken und neue Ansätze für Organisation und Gestaltung finden. Gerade die Nachverdichtung ermöglicht auch eine Reparatur und Regeneration des Territoriums, das durch die Urbanisierung geschädigt wurde.

Wie die Decke des Veranstaltungsraumes im Erlacherhof bezeugt, besticht der Bau innen mit pompösen Details. Foto von 2024 © Caroline Tanner
Widmer zeigte eindrücklich, dass die eigene Vergangenheit der Schweizer Stadt ein Vorbild sein kann: Mittelalterliche Städte, die durch kollektive Anstrengungen entstanden, sind aus heutiger Sicht dicht bebaut und bei der Bevölkerung beliebt. Seit dem Mittelalter haben sich die Stadtgrenzen jedoch stark ausgedehnt. Das jüngste Erbe im grossen Massstab ist für viele Schweizer Städte der Baubestand aus der Nachkriegszeit, der sich um die Stadtzentren herum unter Einwirkung wachsender Automobilität entwickelte. Im Gegensatz zu den Kernstädten sind die Agglomerationen bei der Bevölkerung weniger beliebt. Gerade diese Gebiete haben heute ein hohes Potenzial für städtische Transformationen.

Im Stadtzentrum von Genf fügen sich die Fassaden zu einem erkennbaren Ganzen. © Matthieu Gafsou, 2022/Etat de Genève
Was bedeutet Urbanität?
Mit der räumlichen Expansion der Städte in das umliegende Gelände stellt sich die Frage: Was gehört eigentlich zur Stadt? Widmer hob hervor, dass Urbanität heute unterschiedliche Gebiete, Gesichter und Zeitschichten umfasst. Eine zukunftsfähige Stadtentwicklung muss diese Komplexität anerkennen und daraus Chancen ableiten. In diesem Kontext spielt die Stadt der kurzen Wege eine Schlüsselrolle: Wohnen, Arbeiten und Freizeit sollen wieder in Fussdistanz erreichbar sein.
Kollaboration – auch über Gemeinde-, Kantons- und Landesgrenzen hinaus – ist für Widmer ein wichtiges Stichwort für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Die Herausforderung besteht darin, bestehende Strukturen so umzugestalten, dass qualitativ hochwertige Lebensräume entstehen. Widmer betonte, dass dafür auch Mut und ein kollektives Engagement nötig sind. Veränderungen sollen dabei partizipativ gestaltet werden, um die Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort zu berücksichtigen.

Die Urbanität des Stadtzentrums Genf ist offensichtlich, während die Agglomerationen heute oft strukturlos wirken. © Matthieu Gafsou, 2022/Etat de Genève
Die lebenswerte Stadt der Zukunft hängt wesentlich von baukulturellen Qualitäten ab. Wie Widmer unter Rückgriff auf Art. 1 des RPG nahelegte, ist ein harmonisches Gleichgewicht zwischen der natürlichen Umgebung und den Bedürfnissen der Menschen essenziell. Anders als in der Nachkriegszeit werden künftig Städte, so Widmer, nicht durch eine massive Flächenausdehnung entstehen. Als Kantonsplanerin von Genf, wo das unbebaute Land schon länger rar ist, hat sie viel Erfahrung mit Innenverdichtung. Als wichtiges Planungsinstrument dient die qualitative Nachverdichtung dazu, den Bestand mit Blick auf baukulturelle Qualitäten weiterzuentwickeln.
Die Städte müssen gleichzeitig durchlässig und grün sein. Denn eine hohe Lebensqualität braucht auch gut gestalte öffentliche Räume und Freiräume. Dass die Zentren sich wegen des Klimawandels erhitzen, betont die Wichtigkeit dieses Grundsatzes. Ein weiterer zentraler Punkt ist der ökonomische Umgang mit Ressourcen. Widmer appellierte für die Nutzung grauer Energie im Bestand und für die Wiederverwendung des Materials («Re-Use»). Für sie ist klar: «Wir müssen bei der hohen Baukultur beginnen. Denn die Liebe zu unseren Städten liegt in der Fähigkeit, sie als Räume zu gestalten, in denen sich Menschen wohlfühlen.»

Die dicht bebauten Altstädte mit ihren kleinteiligen Dachlandschaften sind in der Schweiz nach wie vor sehr beliebt. Bern 1979 © ETH- Bibliothek Zürich/Bildarchiv
Baukultur als Schlüsselelement
Mit den Worten: «Was wir heute bauen, ist unser Erbe von morgen» rief Ariane Widmer zu einem gemeinsamen Engagement für lebenswerte Städte auf. Sie erinnerte daran, dass Innovation und Baukultur keine Gegensätze sind, sondern Hand in Hand gehen können. Städte, die lebenswert und ästhetisch ansprechend sind, entstehen durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Fachleuten und der Gesellschaft. Der Gründungsanlass verkörperte schliesslich eine wichtige Botschaft: Die Gestaltung der Städte von morgen beginnt mit dem Handeln von heute.
Caroline Tanner
Caroline Tanner ist Architektin, Autorin und Philosophin. Sie studierte Architektur an der ETH Zürich und arbeitete mehrere Jahre als Architekturjournalistin bei den NZZ Fachmedien. 2024 hat sie den «Master in Geschichte und Philosophie des Wissens» mit einer Arbeit in Architekturphilosophie mit der Bestnote abgeschlossen.

Stiftung Baukultur Schweiz
Die Stiftung Baukultur Schweiz ist eine nationale, neutrale und politisch unabhängige Stiftung. Im Frühjahr 2020 gegründet, bringt sie Akteure zusammen, schafft Plattformen, initiiert Prozesse und macht sich stark für jene, welche die Grundlagen der Baukultur inhaltlich ausarbeiten oder diese in der Praxis umsetzen.