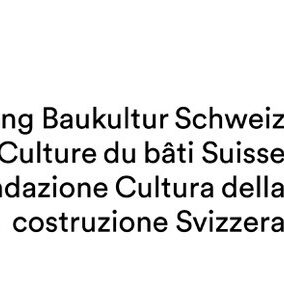2 février 2023
Stiftung Baukultur Schweiz | D'un point vue personnel
«Hohe Baukultur ist eine Haltung, eine Überzeugung, eine Investition»
Die Stiftung Baukultur Schweiz wurde im Frühjahr 2020 als nationale, neutrale und politisch unabhängige Stiftung gegründet. Zwei Jahre später reden wir mit Enrico Slongo, Stadtarchitekt in Freiburg und Stiftungsratspräsident, über Baukultur.
Herr Slongo, seit zwei Jahren präsidieren Sie die Stiftung Baukultur Schweiz. Wie kommt es, dass Sie hier mittun?
Das hat mit meinem Werdegang zu tun: Ich studierte Architektur und arbeitete in der Privatwirtschaft als Architekt, später folgte ein Studium der Raumplanung, und schliesslich folgte die Behördenarbeit. Als Stadtbaumeister von Langenthal versuchte ich, gewisse Prozesse einzuführen – vielleicht auch unkonventionelle –, die ich als qualitätssichernde Massnahmen verstehe. Das dürfte auch dazu geführt haben, dass Langenthal 2019 den Wakkerpreis erhielt.
Herr Slongo, seit zwei Jahren präsidieren Sie die Stiftung Baukultur Schweiz. Wie kommt es, dass Sie hier mittun?
Das hat mit meinem Werdegang zu tun: Ich studierte Architektur und arbeitete in der Privatwirtschaft als Architekt, später folgte ein Studium der Raumplanung, und schliesslich folgte die Behördenarbeit. Als Stadtbaumeister von Langenthal versuchte ich, gewisse Prozesse einzuführen – vielleicht auch unkonventionelle –, die ich als qualitätssichernde Massnahmen verstehe. Das dürfte auch dazu geführt haben, dass Langenthal 2019 den Wakkerpreis erhielt.
Wie definieren Sie hohe Baukultur und weshalb setzen Sie sich dafür ein?
Für mich ist es ein Überbegriff, dem verschiedene Themen unter einem ganzheitlichen Verständnis innewohnen: Aus Behördensicht müssen die Prozesse stimmen, damit eine hohe Bau-, oder Lebensraumqualität entsteht. Diese hohe Qualität bildet sich in der Gesellschaft, der Landschaft, der Umwelt und im Ortsbild ab und muss wirtschaftlich tragbar sein.
Diese Gesamtbetrachtung beinhaltet für mich ganz architektonisch den Entwurf. Ein ganzheitlicher Entwurf in einem guten Prozess führt zu hoher Baukultur. Ich sehe auch die Stadt als Entwurf: Die Idealvorstellung wäre, möglichst keine Baugesetze zu haben und nur den Entwurf wirken zu lassen. Leider ist das nicht immer realistisch. Mit gewissen Prozessen kann man dies herbeiführen, aber am Ende braucht es dennoch demokratische Instrumente, wie es zum Beispiel Einsprachen darstellen. Mich interessiert, die Prozesse aufeinander abzustimmen.
Dann führt eine hohe Baukultur also nicht zu mehr Reglementierungen?
In meiner Idealvorstellung nicht – im Gegenteil. Aber es denken nicht alle so wie ich. Ausserdem sollte ein Nachbar, eine Nachbarin wissen, was in seiner oder Ihrer Nachbarschaft passiert und seine Meinung kundtun dürfen. Aber man kann nur gegen das Baureglement, das nicht zwangsweise hohe Baukultur garantiert, Einspruch erheben. Deshalb finde ich Prozesse wie Gestaltungspläne oder Bebauungsordnungen – unterschiedliche Begriffe je nach Kanton –, sehr spannend. Hier sind in einem abgesteckten Perimeter spezifische Anpassungen der Grundregel möglich, die sich vorgängig an qualitätssichernden Verfahren prüfen und diskutieren lassen.
Und weshalb ist Baukultur nicht selbstverständlich? Weshalb müssen wir uns dafür stark machen?
Ich glaube, das ist gesellschaftlich und geschichtlich bedingt: In der Schweiz gibt es den klassischen Städtebau erst seit Kurzem. Nun mögen einige widersprechen, aber was ich sagen will, ist, dass es die klassische Ausbildung zum Städtebauer, dem neudeutschen urban designer, erst seit ungefähr 15 Jahren gibt. Davor war der Städtebau Teil der Architekturausbildung. Hatte man ein Diplom als Architekt oder Architektin, war man auch ausgebildet in Städtebau.
Früher, also bis 2013, vor der Revision des Raumplanungsgesetzes RPG, konnte man ausserdem quasi beliebig Land einzonen. Danach fand ein Paradigmenwechsel mit der Entwicklung nach Innen statt, und man muss deshalb heute mehr Rücksicht aufeinander nehmen und andere Fragen stellen. Der Anspruch der Gesellschaft an eine hohe Baukultur wird somit grösser, weil sie uns alle mehr betrifft.
Ist Baukultur dabei nicht einfach auch ein Modewort wie die omnipräsente Nachhaltigkeit, unter dem ganz vieles subsummiert wird, damit man ein Immobilienprojekt besser vermarkten kann?
Da sehe ich keine Gefahr. Hohe Baukultur ist eine Haltung, eine Überzeugung, eine Investition. Gleichzeitig kann man mit Labels immer Marketing betreiben.
Wie überzeuge ich den grossen Immobilienplayer oder die Landbesitzerin vom Mehrwert der Baukultur?
Eigentlich betreiben wir tagtäglich Aufklärung. In Freiburg ist ein Mittel das Instrument der «Ateliers», in Langenthal nannten wir es «Workshops». Um das zu erklären, muss ich ein wenig ausholen: Wenn eine Bauherrschaft mit einem beauftragten Architekten etwas erstellen will, dann entwickelt letzterer ein Projekt, ohne grossen Kontakt zu Bauinspektorat oder dem Stadtarchitekten, der Stadtarchitektin. Nachdem rund 30 Prozent des Honorars geflossen sind, erfolgt das Baugesuch, um eine Baubewilligung zu erhalten. Je nach Relevanz zum Kontext geht die Baubewilligung vor die Baukommission. In der Regel Politikerinnen und Politiker, begleitet von Experten ohne Stimmrecht (so war es in Langenthal). In grösseren Städten sind diese Kommissionen professionalisierter, da gibt es ein Baukollegium oder die Stadtbildkommission – je nach Kanton wieder anders benannt. Sollte der architektonische Entwurf von dieser gerügt werden, gibt der Architekt der Bauherrschaft zu verstehen, die Baukommission sei schuld und er könne leider nichts dafür, viel mehr, er müsse das Projekt überarbeiten.
Das veranlasste mich dazu, dass man die Architektinnen und Architekten in einem sensiblen Gebiet in ihrem Entwurf begleitet. In der Vorprojektphase gibt es dafür vier bis fünf «Ateliers». Was dabei zwingend ist: Ohne Architekt und Bauherrschaft finden kein Treffen statt, beide müssen am Tisch sitzen. So erfährt die Bauherrschaft, wie gut oder schlecht ihr Architekt ist. Sie sieht, welche Leistung sie erhält, kann sich selber einbringen und ist dann auch in ökonomischer Hinsicht überzeugt.
Ihr Wunschziel wäre weniger Reglemente. Brauchen wir dennoch eine angepasste Gesetzgebung, damit die Baukultur darin verankert werden kann? Gab es dementsprechend schon Vorstösse von der Stiftung?
Ja. Ich setzte mich sehr dafür ein, dass im Zusammenhang mit der Biodiversitätsinitiative der Artikel 17 aufgenommen wird, worin die hohe Baukultur vorkommt. Und zwar deshalb, weil wir in Freiburg zum Beispiel sehr schlecht aufgestellt sind, wenn für uns die architektonische Qualität nicht stimmt, obwohl alle Reglemente eingehalten wurden. Wir haben keinen kantonalen Gestaltungsartikel mit Schlagworten wie «architektonische Qualität» oder «architektonischer Ausdruck» oder «Integration ins Ortsbild». Das bedeutet, dass die zuständigen kantonalen Ämter sich schwertun, uns bei dieser Thematik zu unterstützen. Im Kanton Bern zum Beispiel kann sich die Gemeinde auf das kantonale Baugesetz berufen. Das ist aber nicht in jedem Kanton der Fall. Wenn nun aber der Bund die hohe Baukultur in seiner Bundesverfassung stehe hätte, dann könnten sich Gemeinden bei fehlenden kantonalen Gesetzen auf das Bundesgesetz berufen, die nächst höhere Instanz.
Interviewerin: Jenny Keller, Stiftung Baukultur Schweiz